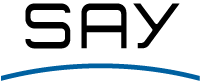Barrierefreiheit
im Netz
Ein wesentlicher Bestandteil einer inklusiven Gesellschaft
Warum Barrierefrei?

Barrierefreiheit
im Internet
bedeutet, digitale Inhalte so zu gestalten,
dass sie für alle Menschen zugänglich sind,
unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen.
Was für manche selbstverständlich funktioniert,
kann für andere zur echten Herausforderung werden:
winzige Buttons, fehlende Alternativtexte oder komplexe Navigationen schließen Millionen Menschen aus.
Dabei geht es nicht nur um gesetzliche
Vorgaben oder technische Standards,
sondern um digitale Teilhabe.
Ein barrierefreies Web ist inklusiv, benutzerfreundlich und oft ganz nebenbei auch besser für Suchmaschinen und mobile Geräte.

Kurz gesagt:
Wer Barrieren abbaut, schafft Verbindungen.
Was kam 2025 hinzu?

Mit dem Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) am 28. Juni 2025 wurde die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit:
– der sogenannte European Accessibility Act –
offiziell in deutsches Recht überführt.
Das bedeutet:
Die Anforderungen an digitale Barrierefreiheit werden deutlich ausgeweitet.
Unternehmen, Dienstleister und Betreiber digitaler Angebote stehen nun stärker in der Verantwortung, ihre Produkte und Services für alle zugänglich zu machen – von Websites über Apps bis hin zu E-Books und Selbstbedienungsterminals.
Das Ziel ist klar:
Niemanden ausschließen
Sicherheit und Vertrauen
Eine digitale Umgebung, die niemanden ausschließt und die Vielfalt der Nutzer*innen aktiv mitdenkt.
Wer jetzt handelt, schafft nicht nur rechtliche Sicherheit, sondern auch Vertrauen und Reichweite.

Wie wird Barrierefrei definiert?
WCAG-Konformitätsstufen
Die WCAG unterteilt Barrierefreiheit in drei Stufen:
A
Grundlegende
Anforderungen
AA
Standard für eine
umfassende Barrierefreiheit
AAA
Erfüllung der höchsten
Barrierefreiheitsstandards

Die WCAG basieren auf vier zentralen Prinzipien,
die digitale Inhalte für alle Menschen zugänglich machen.
Percievable
(Wahrnehmbarkeit)
Inhalte müssen so gestaltet sein, dass sie visuell oder auditiv erfasst werden können. Das bedeutet zum Beispiel Textalternativen für Bilder, Untertitel für Videos und ausreichende Farbkontraste, damit niemand wichtige Informationen übersieht.
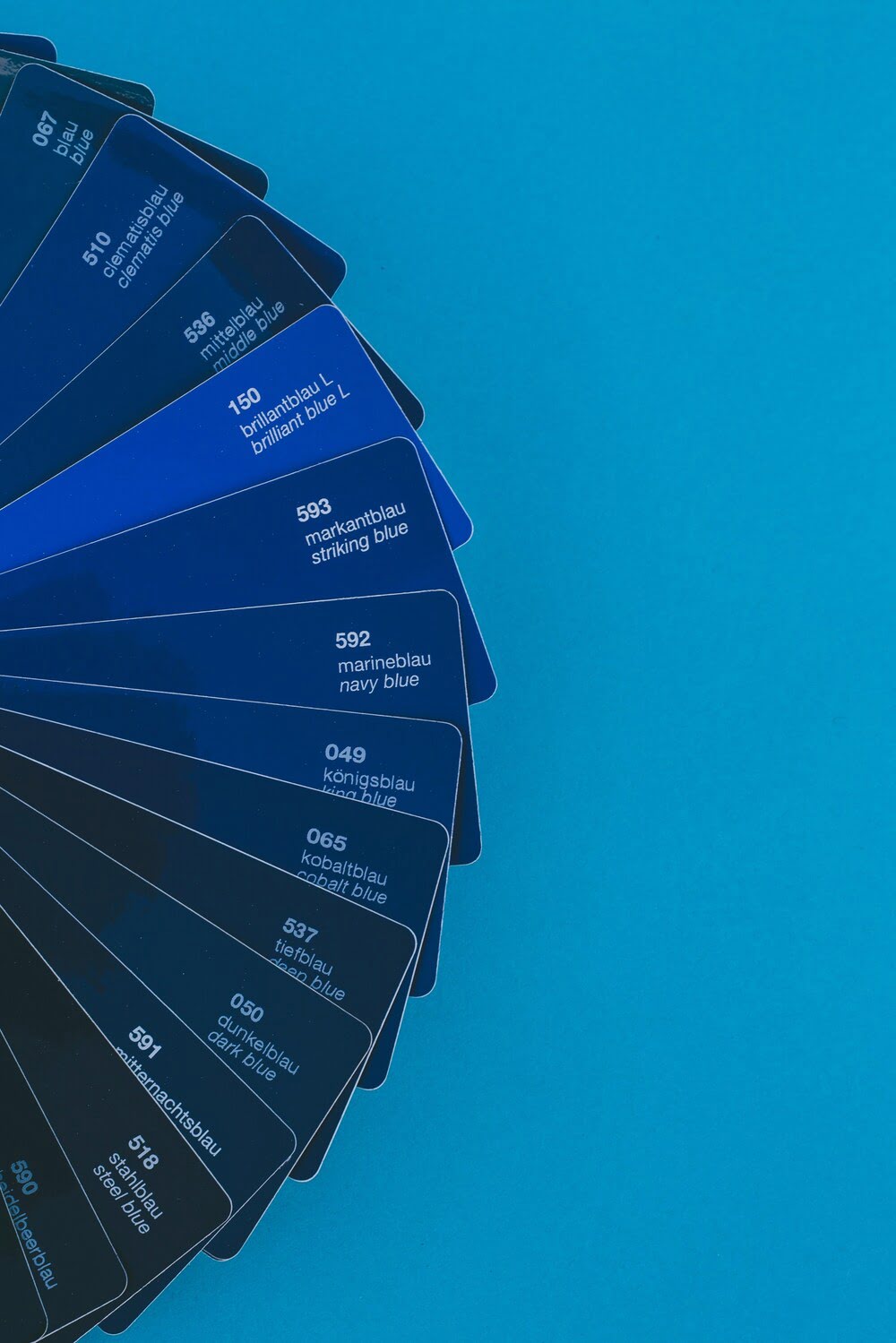
Operable
(Bedienbarkeit)
Alle interaktiven Elemente müssen für unterschiedliche Eingabemethoden erreichbar und nutzbar sein. Das umfasst die vollständige Tastatursteuerung, logische Tab-Reihenfolgen und genügend Zeit für Nutzungsaktionen, damit keine Steuerungshürde entsteht.
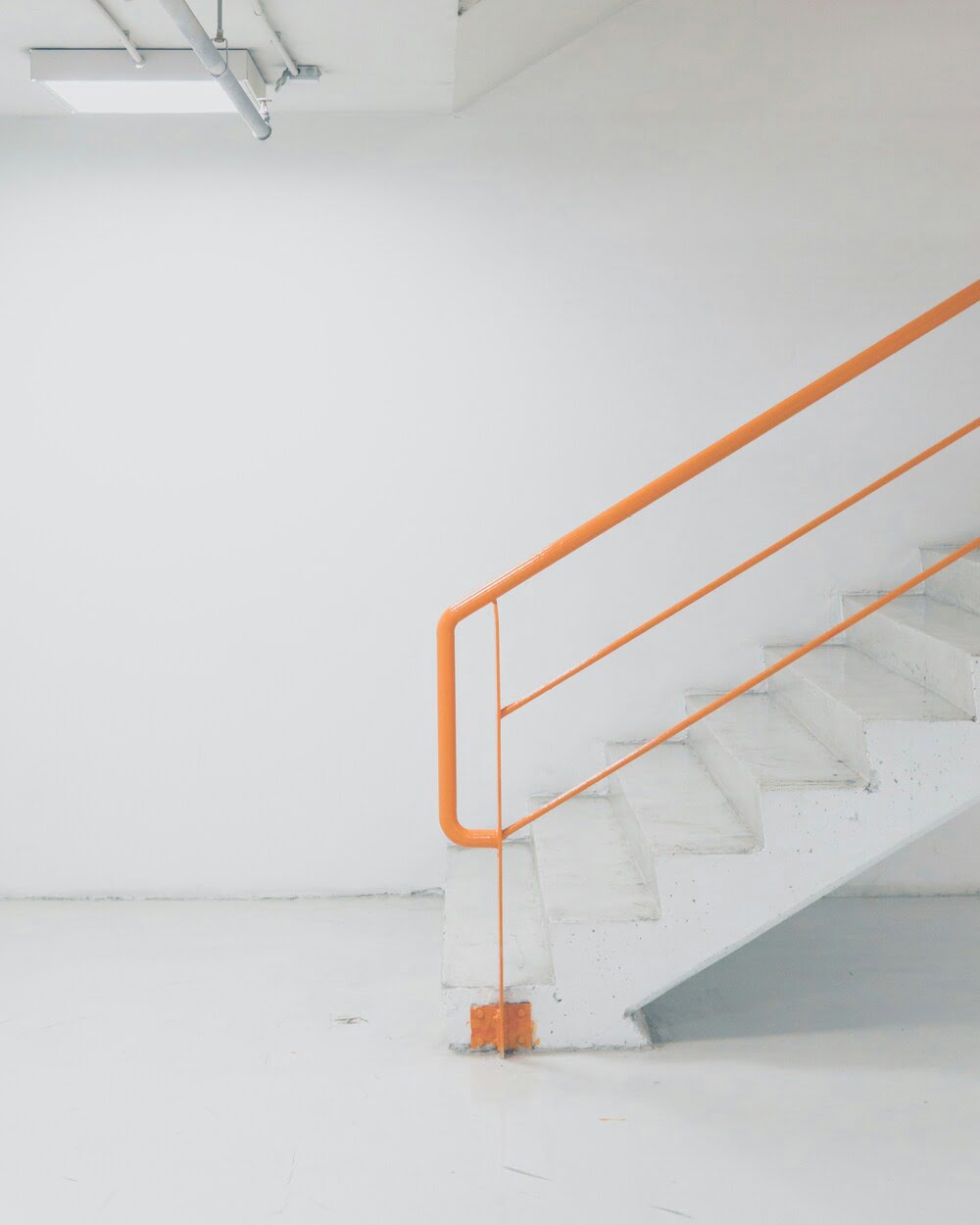
Understandable
(Verständlichkeit)
Informationen und Bedienelemente sollten klar, konsistent und vorhersehbar sein. Einfache Sprache, eindeutige Fehlermeldungen und einheitliche Navigation helfen, Missverständnisse zu vermeiden und auch neuen Nutzenden den Zugang zu erleichtern.

Robust
(Robustheit)
Webinhalte müssen mit aktuellen und zukünftigen Technologien kompatibel bleiben. Durch sauberen, validen Code und den Einsatz semantischer HTML-Elemente oder ARIA-Attributen stellen Sie sicher, dass Assistive Technologien Ihre Seite zuverlässig interpretieren können.


Wen und Was
betrifft Barrierefrei?
Web-Inhalte und digitale Dienste
1
Sämtliche neuen Inhalte im Internet, nicht nur von öffentlichen Einrichtungen, müssen gemäß WCAG 2.1 auf der Stufe AA barrierefrei gestaltet sein.
Firmen, darunter Betreiber von E-Commerce-Plattformen, sind verpflichtet, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten.
2
Unternehmen
Produkte
3
Bestimmte technische Geräte, wie Computer, Smartphones, Geld- und Fahrkartenautomaten, internetfähige Fernseher und E-Reader, müssen barrierefrei nutzbar sein.
Auch Bereiche wie Telekommunikation, Bankwesen, Software für E-Books und Teile des Personenverkehrs fallen unter die neuen Anforderungen.
4
Dienstleistungen
Informationspflicht
Unternehmen müssen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen erklären, wie ihre Dienstleistungen die Barrierefreiheitsvorgaben erfüllen.
Diese Regelungen gelten für alle Produkte und Dienstleistungen, die ab dem Stichtag neu auf den Markt kommen.
Die EU hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte bei der Zugänglichkeit digitaler Inhalte erzielt.
Seit September 2020 müssen alle Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Einrichtungen innerhalb der EU barrierefrei sein.
Grundlage hierfür ist die EU-Richtlinie 2016/2102, welche nationale Gesetze in den Mitgliedsstaaten prägt.
Die zugrunde liegenden Anforderungen orientieren sich an den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in Version 2.1.
Was muss gemacht werden?
ABC
Kontraste
Guter Farbkontrast bedeutet, Texte, Icons und Bedienelemente so zu gestalten, dass sie für alle Nutzerinnen und Nutzer gut lesbar sind – ganz gleich, ob sie eine Sehschwäche haben oder ihr Bildschirm in grellem Sonnenlicht spiegelt. Ohne ausreichende Differenzierung verschwimmen Inhalte, Buttons wirken unsichtbar und wichtige Informationen gehen verloren.
Als Faustregel gilt: Für Fließtext und Hintergrund sollten Sie eine Kontrastratio von mindestens 4,5 : 1 wählen, bei großen Überschriften (ab 18 pt beziehungsweise 14 pt fett) genügt 3 : 1. Nutzen Sie Online-Tools oder Browser-Erweiterungen, um Ihre Farbkombinationen direkt im Entwurf zu prüfen und Fehlerquellen rechtzeitig zu erkennen.
Kontraste sind mehr als ein technischer Standard – sie stehen für digitale Teilhabe. Wer auf klare Unterscheidbarkeit setzt, verbessert nicht nur die Zugänglichkeit für Menschen mit Einschränkungen, sondern steigert auch die Nutzerfreundlichkeit insgesamt. Zusätzlich profitieren Suchmaschinen und mobile Geräte von einem strukturierten, gut lesbaren Design. Wer Barrieren im Farbkonzept abbaut, schafft Verbindungen im Netz.
Tastatursteuerung
Tastatursteuerung bedeutet, alle interaktiven Elemente so zu gestalten, dass sie ohne Maus erreichbar und bedienbar sind – egal, ob Nutzerin, Nutzer oder Assistivtechnik am Werk ist.
Fehlen eindeutige Fokus-Indikatoren oder ist die Tab-Reihenfolge unlogisch, geraten Menüs unauffindbar, Buttons wandern aus dem Blickfeld und Formulare werden zur Hürde.

Als Faustregel gilt:
Jede Funktion muss per Tab, Enter oder Leertaste aktivierbar sein. Setzen Sie dabei auf semantisches HTML, statt reine Click-Events in JavaScript zu verwenden.
Nutzen Sie „tabindex“ konsequent, um die Navigation zu steuern, und bieten Sie „Skip-Links“ an, mit denen sich Anwender zielsicher zu Hauptinhalten oder Navigationsbereichen springen können.
Testen Sie Ihre Seite regelmäßig rein über die Tastatur, um blinde Flecken aufzudecken.
Tastaturfreundlichkeit ist mehr als ein technischer Standard – sie steht für digitale Teilhabe.
Wer die Bedienung mit Tasten optimiert, eröffnet Menschen mit motorischen Einschränkungen oder Screenreadern uneingeschränkte Zugänge. Gleichzeitig profitiert jeder von schnellen Shortcuts und klaren Strukturen.
Wer Barrieren in der Steuerung abbaut, schafft reibungslose Verbindungen im Netz.
Schriftgrößen
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gut gewählte Schriftgrößen sind essenziell für barrierefreies Webdesign – sie entscheiden darüber, ob Inhalte mühelos erfasst oder mühsam entziffert werden.
Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, ältere Nutzerinnen und Nutzer oder Personen mit kognitiven Einschränkungen sind besonders auf klar lesbare Texte angewiesen.
Zu kleine Schriftgrößen führen schnell zu Überanstrengung, Frustration und letztlich zum Absprung von der Website.
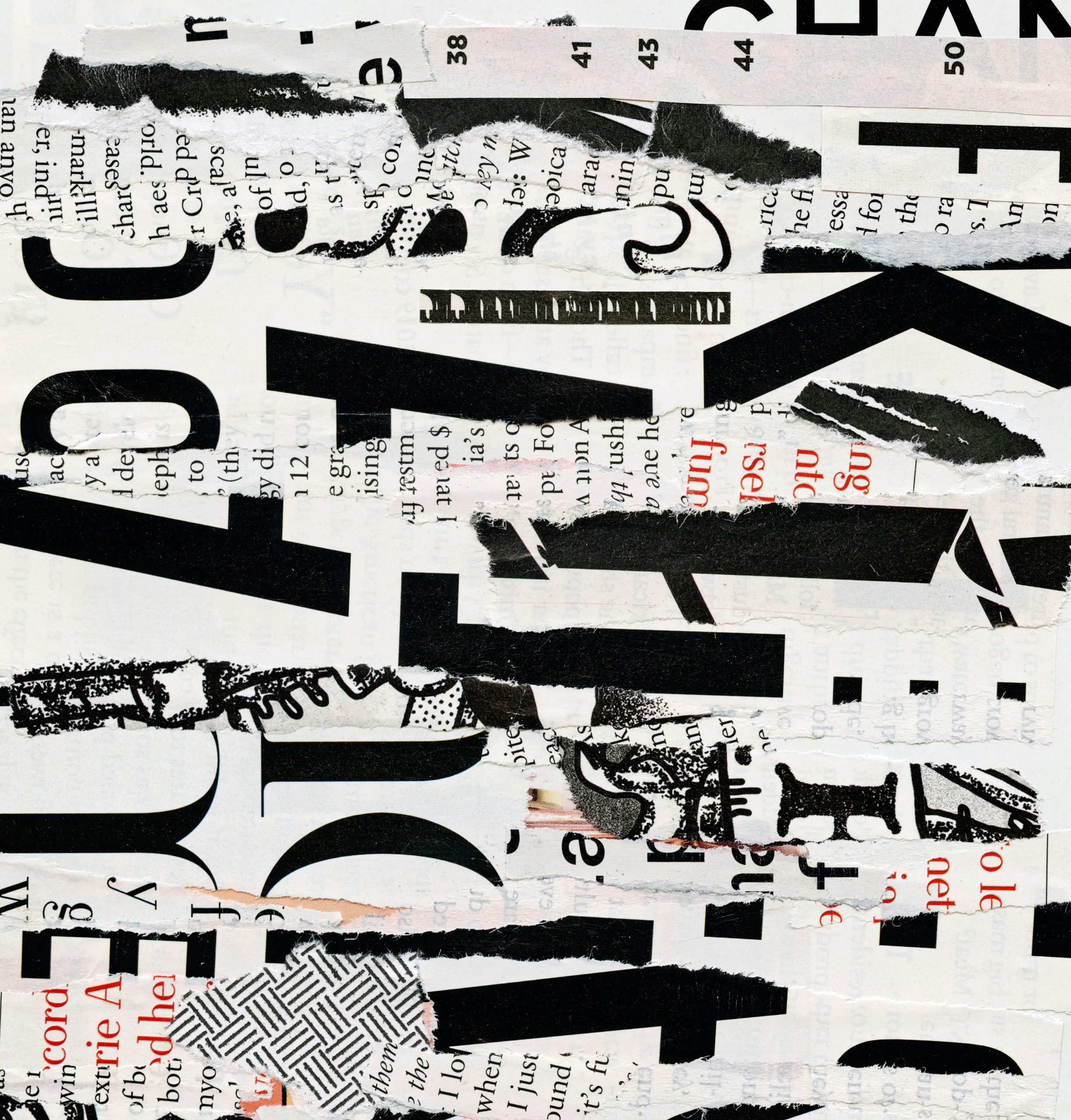
Als Faustregel gilt: Verwenden Sie für Fließtext mindestens 16 px, für kleinere Hinweise oder Labels nicht unter 14 px. Überschriften sollten deutlich größer und visuell abgesetzt sein, um die Struktur der Inhalte zu unterstützen.
Verzichten Sie auf feste Pixelwerte und setzen Sie stattdessen auf relative Einheiten wie „em“ oder „rem“, damit Nutzer die Schriftgröße bei Bedarf individuell anpassen können. Achten Sie zudem auf ausreichenden Zeilenabstand (mindestens 1,5-fach) und eine gut lesbare Schriftart ohne Schnörkel.
Lesefreundliche Schriftgrößen sind mehr als ein technischer Standard – sie stehen für digitale Teilhabe.
Wer auf flexible Typografie setzt, ermöglicht selbstbestimmtes Lesen und stärkt die Informationsaufnahme. Auch mobile Geräte und responsive Layouts profitieren von skalierbarer Schrift.
Wer Barrieren in der Textgestaltung abbaut, schafft Verständlichkeit und Vertrauen im Netz.
Textbeispiel
Viele Menschen haben Schwierigkeiten, komplexe Texte im Internet zu verstehen. Besonders betroffen sind Personen mit kognitiven Einschränkungen oder geringen Sprachkenntnissen. Deshalb ist es wichtig, Inhalte möglichst klar und zugänglich zu formulieren.
Textbeispiel Leichte Sprache
Manche Menschen verstehen schwere Texte nicht gut. Sie brauchen einfache Wörter und kurze Sätze. So können sie die Informationen besser lesen und verstehen.
Leichte Sprache
Leichte Sprache macht digitale Inhalte für möglichst viele Menschen verständlich – besonders für Personen mit Lernschwierigkeiten, geringen Deutschkenntnissen oder kognitiven Einschränkungen. Komplexe Satzstrukturen, Fachbegriffe und abstrakte Formulierungen können schnell zur Barriere werden. Wer stattdessen auf klare, einfache und direkte Sprache setzt, öffnet den Zugang zu Informationen und fördert die Selbstständigkeit der Nutzerinnen und Nutzer.
Als Faustregel gilt: Verwenden Sie kurze Sätze mit nur einer Aussage, vermeiden Sie Fremdwörter oder erklären Sie sie direkt. Nutzen Sie aktive Formulierungen, einfache Wörter und eine klare Gliederung mit Zwischenüberschriften und Listen. Ergänzen Sie Texte mit unterstützenden Bildern oder Symbolen, um das Verständnis zu erleichtern. Lassen Sie Inhalte von Menschen mit Behinderungen testen oder prüfen Sie sie mit Tools und Leitfäden zur Leichten Sprache.
Leichte Sprache ist mehr als ein technischer Standard – sie steht für digitale Teilhabe. Wer verständlich kommuniziert, erreicht mehr Menschen und stärkt die Inklusion. Auch Nutzerinnen und Nutzer mit Zeitdruck, Stress oder geringer Lesekompetenz profitieren von klaren Botschaften. Wer sprachliche Barrieren abbaut, schafft echte Verständigung im Netz.
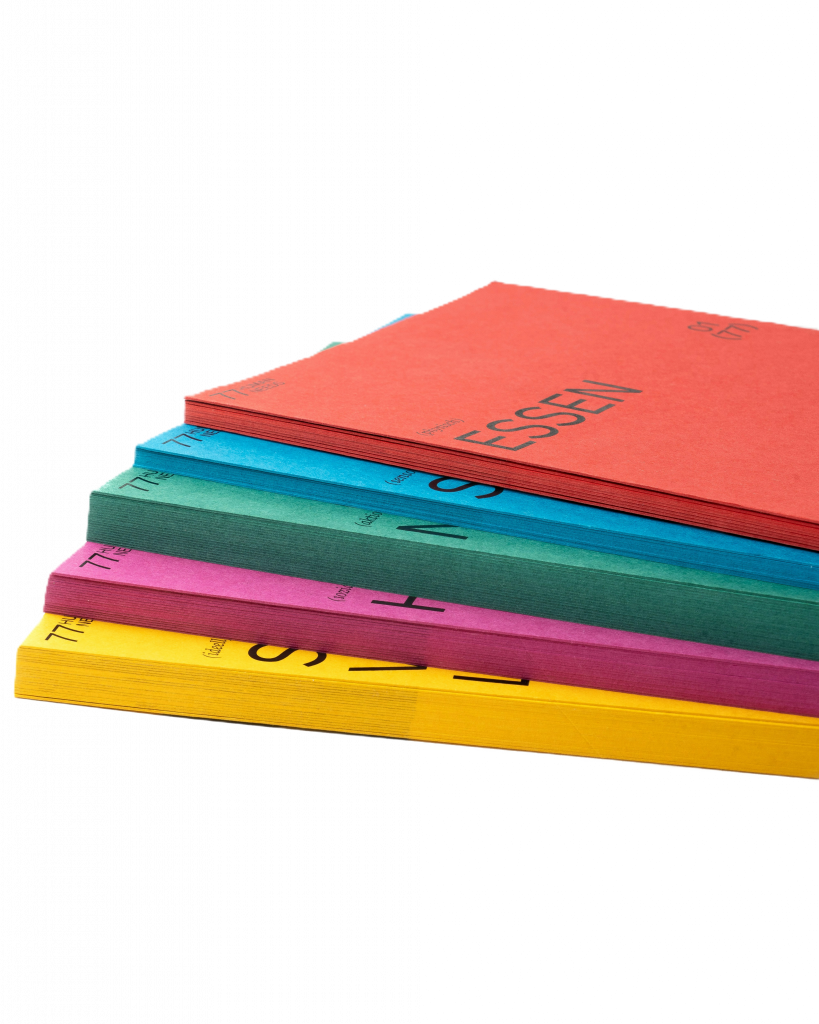
Interaktive Elemente
Als Faustregel gilt:
Interaktive Elemente müssen deutlich als solche erkennbar sein – etwa durch visuelle Hervorhebung, klare Beschriftung und ausreichend Abstand zu anderen Inhalten.
Verwenden Sie semantisches HTML, um die Funktion für Assistenztechnologien nachvollziehbar zu machen, und achten Sie auf sinnvolle Zustände wie „hover“, „focus“ und „active“. Vermeiden Sie versteckte Funktionen oder rein visuelle Hinweise, die ohne Maus oder Touchscreen nicht zugänglich sind.
Testen Sie regelmäßig mit verschiedenen Geräten und Eingabemethoden, um die Bedienbarkeit für alle sicherzustellen.
Interaktive Elemente wie Buttons, Links, Formulare oder Menüs sind zentrale Bestandteile jeder Website – und zugleich potenzielle Barrieren.
Wenn sie nicht klar erkennbar, konsistent gestaltet oder intuitiv bedienbar sind, verlieren Nutzerinnen und Nutzer schnell die Orientierung.
Besonders Menschen mit motorischen oder kognitiven Einschränkungen sowie Nutzer von Screenreadern sind auf eine durchdachte Gestaltung angewiesen, um sicher und selbstständig zu navigieren.
Barrierefreie Interaktionen sind mehr als ein technischer Standard – sie stehen für digitale Teilhabe.
Wer auf klare, konsistente und zugängliche Bedienelemente setzt, stärkt die Selbstwirksamkeit der Nutzer und schafft Vertrauen. Auch mobile Nutzer und Suchmaschinen profitieren von einer sauberen, strukturierten Umsetzung.
Wer Barrieren in der Interaktion abbaut, schafft echte Verbindung im Netz.
Programmierung
Barrierefreie Webentwicklung beginnt nicht erst beim Design.
Sie ist tief in der Programmierung verankert. Sauberer, semantischer Code bildet die Grundlage für eine Website, die von allen Menschen genutzt werden kann – unabhängig von ihren Fähigkeiten oder eingesetzten Hilfsmitteln.
Wenn Entwickler auf zugängliche Strukturen achten, ermöglichen sie Screenreadern, Tastatursteuerungen und anderen Assistenzsystemen eine zuverlässige Interpretation und Bedienung der Inhalte.

Als Faustregel gilt:
Verwenden Sie HTML-Elemente entsprechend ihrer Bedeutung – etwa <button> statt <div> für klickbare Aktionen oder <label> für Formularfelder. Ergänzen Sie ARIA-Rollen nur dort, wo semantisches HTML nicht ausreicht, und vermeiden Sie übermäßige JavaScript-Abhängigkeiten, die die Zugänglichkeit einschränken können.
Achten Sie auf valide, fehlerfreie Markup-Strukturen und testen Sie regelmäßig mit automatisierten Tools sowie echten Nutzerinnen und Nutzern. Dokumentieren Sie barrierefreie Anforderungen im Code, damit sie im Team konsequent umgesetzt werden.
Barrierefreie Programmierung ist mehr als ein technischer Standard – sie steht für digitale Teilhabe. Wer auf saubere, zugängliche Codebasis setzt, schafft nachhaltige Lösungen, die für alle funktionieren. Gleichzeitig verbessert sich die Wartbarkeit, Performance und Kompatibilität der Website. Wer Barrieren im Code abbaut, schafft stabile Verbindungen im Netz.